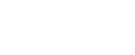- Lösungen & Produkte
- Lösungen
- Reichweite erhöhen
Mehr Sichtbarkeit für Ihre Inhalte durch zielgenaue Verbreitung
- Reichweite messen
Überprüfen Sie die Wirkung Ihrer PR-Arbeit.
- KI-Tools der APA
KI-Tools für Bild, Text und Sprache
- Reichweite erhöhen
- Produkte
- APA-NewsDesk
Medien - & Datenhub
- PR-Desk
Verbreiten, Beobachten und Recherchieren in einem Tool
- OTS
Der direkte Weg zu Medien, Pressestellen und ins Web
- APA-NewsDesk
- Produkte
- Medienbeobachtung
Alle relevanten Medienartikel frühmorgens und online verfügbar
- Content on Demand
Texte, Bilder, Grafiken und Videos in optimaler Komposition
- APA-PictureDesk
Österreichs größtes Bildangebot für News, Kreatives, Society u.v.m.
- Medienbeobachtung
- Produkte
- Housing und Hosting
Hochverfügbare und ausfallsichere IT-Infrastruktur mit 24/7-Support
- APA-Pressezentrum
High-Tech-Location mit Top-Betreuung für Ihre Events
- CompanyGPT by APA
DSGVO-konforme KI-Lösung
- Housing und Hosting
Kontaktieren Sie uns
- Lösungen
- Wissen & Netzwerk
- Blogbeiträge
- Rechtliche Fragen beim Einsatz von KI
Hier erfahren Sie, wie Sie mit rechtlichen Fragen im Bereich KI umgehen müssen.
- Urheberrecht bei Fotos: Kennen Sie Ihre Bildrechte?
Kein Foto ohne Urheber- und Bildrechte - unsere Guidelines
- Rechtliche Fragen beim Einsatz von KI
- Wissen
- Blog
Interne & externe Branchennews mit dem APA-Blog
- APA-Faktencheck
APA-Faktenchecks im Kampf gegen Falschinformationen
- Blog
- Weiterbildung
- APA-Campus
Workshops und Lehrgänge für PR und Journalismus
- KI-Kompakt
KI-Kompetenz erweitern mit APA-Campus
- Whitepaper & Co.
Profitieren Sie vom Insider-Wissen unserer ExpertInnen
- APA-Campus
- Newsletter
- APA-Value
Aktuelles aus der APA-Gruppe
- APA-CommInsider
Aktuelles aus der Welt von APA-Comm
- APA-TechInsider
Aktuelles aus der Welt von APA-Tech
- APA-Value
Kontaktieren Sie uns
- Blogbeiträge
- About APA
- About APA
- About APA-Gruppe
Auftrag, Mission, Eigentümer, Geschichte
- Facts & Figures
Die wichtigsten Zahlen und Daten auf einen Blick
- Auszeichnungen, Zertifikate und Qualitätsinitiativen
Qualität zählt
- About APA-Gruppe
- Nachrichtenagentur
- Die Redaktion
True and unbiased News
- Internationales Netzwerk
Nachrichtenagenturen im Verband
- Alfred-Geiringer-Stipendium
Förderung des Qualitätsjournalismus
- Die Redaktion
- Innovation & Sharing
- Medienübergreifende Lösungen
Die APA als Digital Cooperative
- Innovation Hub
Unser Hub für digitale Innovationen für Medien und Kommunikation
- APA-medialab
Research, Prototyping und Design Sprints
- Medienübergreifende Lösungen
- Presse
- Presseinformationen
Neuigkeiten aus der APA-Gruppe
- Download-Center
Management, APA-Zentrale und Logopakete
- Pressekontakt
Kontaktieren Sie uns
- APA-Value
Aktuelles aus der APA-Gruppe
- Presseinformationen
Kontaktieren Sie uns
- About APA
- Karriere
- Kontakt
Leopold Museum beleuchtet letzte Jahre des Hausgotts Schiele
"Man meint ja, bereits alles über Egon Schiele zu kennen", sinnierte Leopold-Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger am Donnerstag. Dies sei jedoch eine Illusion, habe bis dato doch eine Schau mit dem Fokus auf die späten Jahre des Künstlers gefehlt. Mit der monumentalen Frühlingsausstellung "Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre: 1914-1918" über den Hausgott holt man dies nun nach - und offenbart dabei Überraschendes.
In einer Phase der gesellschaftlichen wie privaten Zeitenwende wird Schieles Arbeit ruhiger, harmonischer anstatt derangierter. Schiele verlässt seine langjährige Lebenspartnerin Wally Neuzil und heiratet Edith Harms, worauf der Neo-Ehemann 1915 auch noch eingezogen und zum Neo-Soldat wird. Und doch gibt der Künstler die Formexperimente seiner frühen Jahre auf und entwickelt sich in Richtung eines realistischeren Stils.
„Die Linien werden weicher, harmonischer“, so Wipplinger über das „Spätwerk“ des Künstlers zwischen dessen 24. und 28. Lebensjahr: „Es ist augenöffnend.“ Kurze Pinselstriche übereinander gesetzt lösen die großen Farbflächen ab.
Gegliedert ist die von Kerstin Jesse und Schiele-Doyenne Jane Kallir kuratierte Schau in neun Kapitel, die Titel tragen wie „Leben in der Armee“, „Landschaft“ oder „Porträts“. Sie demonstrieren die Variantenbreite des Künstlers, nicht zuletzt anhand von singulären Arbeiten wie einem Wildbach oder den Porträts von Soldaten oder Prominenten der Zeit. „Man merkt Porträts immer an, ob Schiele die Person mochte oder nicht“, so Kallir.
Aber nicht nur stilistisch, auch thematisch entwickelt sich Schiele in seinen letzten Lebensjahren weiter. Die Zahl der Selbstporträts geht zurück, die notorische Selbstbespiegelung des Künstlers weicht einem Fokus auf Liebesszenen, Paarkonstellationen und Landschaftseindrücke, aber auch neugefasste Akte.
Lebensnahere Körper lösen die bekannten ausgemergelten Figuren ab. „In den Personen schlägt jetzt ein Herz“, fasst es Kuratorin Jesse zusammen. Und nicht zuletzt zeigen Porträts von Gattin Edith deren wachsende Zweifel an der Ehe, die sich in den Bildern widerspiegelt.
Zugleich werden die typischen Allegorien, einst sehr intim und persönlich grundiert, allgemeingültiger, treten gleichsam das Erbe Gustav Klimts an. „Schiele hat ab 1917 versucht, breite Darstellungen der Conditio humana zu schaffen“, so Kallir. Diese mächtige Wendung wird im letzten Teil der Ausstellung verdeutlicht, in dem Allegorien für ein projektiertes Mausoleum und ein großformatiges Bildnis von Albert Paris von Gütersloh aus dem Minneapolis Institute of Art mögliche Entwicklungswege des Malers aufzeigen.
Diese späten Jahre eines frühen Genies, das 1918 ebenso wie Gattin Edith von der Spanischen Grippe dahingerafft wurde, wird in der Ausstellung in 181 Exponaten nachgezeichnet, davon 135 Kunstwerke. Diese werden flankiert von Archivalien wie dem bis dato noch nie gezeigten Tagebuch von Edith. Was jedoch auch nach der umfassenden Ausstellung zum früh, am Beginn seines Ruhms Verstorbenen offen bleibt ist eine große Frage, die sich auch Hans-Peter Wipplinger nach wie vor stellt: „In welche Richtung hätte sich Egon Schiele entwickelt?“
(S E R V I C E – „Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre: 1914-1918“ im Leopold Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien von 28. März bis 13. Juli. )
Auf der Suche nach aktuellem News-Content?
Die APA-Redaktion liefert rund um die Uhr aktuellen Nachrichten-Content. Egal ob News-Alerts oder ready-made Nachrichtenbeiträge: Wir passen unser News-Angebot an Ihre Anforderungen an. In einem gemeinsamen Gespräch legen wir die Rahmenbedingungen fest. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.